
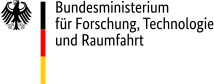
Gefördert wurden innovative Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Mensch-Technik-Interaktion, die Techniken des Internet der Dinge (engl. Internet of Things – IoT) auf Alltagsgegenstände übertragen und so ihre „intelligente Vernetzung“ ermöglichen. Sie gestalteten Alltagsgegenstände durch die Integration von Sensorik und Aktorik interoperabel.
Ziel war es, Daten verschiedener Quellen analysieren und mit Techniken der künstlichen Intelligenz interpretieren zu können, um situationsabhängig Nutzerintentionen und Bedarfe zu erkennen und diese durch Assistenzfunktionen zu bedienen. Die entwickelten Lösungen resultierten in interaktiven Systemen, die insbesondere im Vergleich zu existierenden Ansätzen, Nutzenden eine deutlich verbesserte Alltagsunterstützung und intuitivere Nutzung assistiver Technologien bieten.
Gefördert wurden Innovations- und Technologiepartnerschaften für die Mensch-Technik-Interaktion, durch die Konzepte des IoT auf bisher analoge Alltagsgegenstände übertragen bzw. erweitert wurden, sodass diese durch eine Integration technischer Komponenten intelligenter und intuitiver bedienbar wurden. Durch einen intelligenten Datenaustausch bieten Alltagsgegenstände Menschen aller Altersklassen eine komfortable, zuverlässige und bestenfalls unmerkliche Unterstützung. Um das Vertrauen in die Technik und die Zuverlässigkeit für die Anwenderinnen und Anwender zu gewährleisten, verzahnten die geförderten Projekte neue Software- und Hardwarekonzepte und moderne Sicherheitstechniken unter der stetigen Einbindung der Nutzenden.
Die Förderrichtlinie war in zwei Module gegliedert. Modul 1 diente der Förderung von Verbundprojekten mit klarem Forschungs- und Entwicklungsfokus. Modul 2 zielte auf eine verbundübergreifende Zusammenarbeit und realitätsnahe Evaluation der entwickelten vernetzten Gegenstände im Rahmen von „Living Labs“ ab. Die in Modul 1 entstehenden Demonstratoren wurden als Gesamtsystem schon während ihrer Entwicklung auf Funktionalität und Nutzeffekt hin überprüft.
Die geförderten Projekte widmeten sich eines der folgenden Forschungsthemen:
Parallel zu Modul 1 wurden Living Labs aufgebaut, in denen die Ergebnisse der einzelnen Projekte aus der Bekanntmachung zu einem Gesamtsystem zusammenflossen, das insbesondere in den Bereichen der impliziten Interaktion und dem intelligenten Datenaustausch weit über den internationalen Stand der Technik hinausgeht. Dazu haben sich die in Modul 1 geförderten Projekte auf gemeinsame Standards für den Datenaustausch der Alltagsgegenstände verständigt und sich aktiv an der Entwicklung einer gemeinsamen technischen Plattform beteiligt, durch die eine zuverlässige Interoperabilität der Einzellösungen gewährleistet wurde. Um die enge Zusammenarbeit zu fördern, hat jedes geförderte Projekt aus Modul 1 mit mindestens einem Living Labs kooperiert.
Hier finden Sie die Ergebnissteckbriefe der geförderten Projekte.