
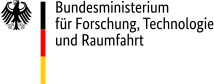
Am 2. und 3. April 2025 fand an der Universität Potsdam das Auftakttreffen zur BMFTR-Fördermaßnahme „Interaktive und Gamification-basierte Technologien zur Förderung der psychischen Gesundheit im Kindesalter“ (GamKi) statt. In den historischen Räumen des Neuen Palais kamen rund 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen.

Die zweitägige Veranstaltung bot ein Programm aus Vorträgen, Projektpräsentationen und thematischen Workshops. Ziel war es, zentrale Herausforderungen und gemeinsame Perspektiven zu diskutieren und die Grundlage für eine nachhaltige Vernetzung der geförderten Vorhaben zu schaffen.

Psychische Erkrankungen im Kindesalter nehmen seit Jahren zu – eine Entwicklung, die durch die COVID-19-Pandemie zusätzlich verstärkt wurde. Während depressive Symptome nach der Pandemie teils zurückgingen, bleiben Angststörungen und psychosomatische Beschwerden auf einem hohen Niveau. Gleichzeitig sind Therapieplätze rar: Kinder warten im Schnitt rund sechs Monate auf eine Behandlung – in einer Lebensphase, in der schnelle Hilfe entscheidend ist. Vor diesem Hintergrund fördert das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Rahmen von GamKi 13 interdisziplinäre Verbundprojekte sowie ein wissenschaftliches Begleitprojekt. Es geht darum, digitale Anwendungen zu entwickeln, die psychotherapeutische Prozesse bei Kindern im Alter von vier bis zwölf Jahren durch interaktive und spielerische Elemente ergänzen – beispielsweise mittels Apps, Serious Games oder Virtual Reality.
Zum Auftakt der Veranstaltung begrüßte Veit Klimpel, der zuständige Referent im BMFTR die Teilnehmenden. In seinem Grußwort betonte er die hohe gesellschaftliche Relevanz der Fördermaßnahme GamKi und verwies auf die besonderen Belastungen, denen Kinder und Familien in den letzten Jahren ausgesetzt waren. Die COVID-19-Pandemie habe dabei wie ein Brennglas gewirkt und bestehende Versorgungsengpässe sowie psychische Belastungen von Kindern sichtbar und unübersehbar gemacht. Gleichzeitig hob Klimpel das Potenzial digitaler Technologien hervor, therapeutische Angebote kindgerecht, flexibel und ortsunabhängig zu ergänzen – insbesondere angesichts langer Wartezeiten und eingeschränktem Zugang. GamKi solle dazu beitragen, psychische Gesundheitsversorgung neu zu denken und Forschung, Technikentwicklung sowie Versorgungspraxis enger miteinander zu verzahnen. Dabei gehe es nicht um eine One-Fits-All-Lösung für alle psychisch-bedingten Krankheitsbilder, sondern um dezidierte Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, die sich in der breiten Aufstellung der wissenschaftlichen Forschungsprojekte widerspiegeln.

Anschließend hielt Prof. Dr. Michael Kölch, Universitätsmedizin Rostock, einen Vortrag über die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen im Kindesalter. Anhand historischer, aber auch aktueller Beispiele zeigte er auf, wie tiefgreifend soziale Ausgrenzung bis heute wirkt – nicht nur für betroffene Kinder, sondern auch für deren Familien. Besonders im Kindes- und Jugendalter seien psychische Auffälligkeiten häufig mit Vorurteilen behaftet, die bis in stereotype Zuschreibungen hineinreichen. So bestehe in der Gesellschaft teils noch immer die Vorstellung, psychische Erkrankungen seien „ansteckend“ – allein durch den Kontakt mit betroffenen Kindern oder Familien. Diese Annahme führe dazu, dass sich soziale Gruppen abgrenzen und betroffene Kinder zunehmend isoliert würden – etwa im schulischen Umfeld oder bei Freizeitaktivitäten. Digitale Anwendungen könnten hier einen Beitrag zur Entstigmatisierung leisten – etwa durch anonyme Nutzung, niedrigschwellige Zugänge oder die Einbindung von Erfahrungsberichten Gleichaltriger, die ähnliche Herausforderungen erlebt haben. Gleichzeitig warnte Prof. Kölch aber vor einer möglichen Überpathologisierung alltäglicher Erlebnisse, insbesondere, wenn digitale Tools zur Dauerbeobachtung oder Selbstoptimierung führten. Es sei daher wichtig, Chancen und Risiken gleichermaßen im Blick zu behalten.

Ergänzend hierzu stellte Prof. Dr. Michael Rapp am zweiten Veranstaltungstag die zentralen Aufgaben und Zielsetzungen des wissenschaftlichen Begleitprojekts vor, das in koordinierender Funktion an der Universität Potsdam angesiedelt ist. Das Projekt GamKi-Wer-Wie-Was hat die Aufgabe, übergreifende Wirkmechanismen technologiegestützter Psychotherapie bei Kindern zu analysieren, die Verbundprojekte methodisch zu unterstützen und verbundübergreifende Themen wie Evaluation, ethische, rechtliche und soziale Aspekte (ELSA) sowie Wissenschaftskommunikation zu bündeln. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung eines theoretischen Modells digitaler Wirkfaktoren und auf der Etablierung einer praxisnahen Austauschplattform. Prof. Rapp betonte, dass das Begleitprojekt nicht nur dokumentieren, sondern aktiv Impulse setzen wolle – etwa im Hinblick auf partizipative Technikgestaltung, Qualitätssicherung und nachhaltige Verwertung. Damit versteht sich das Begleitprojekt auch als Brücke zwischen Forschung, Anwendung und Öffentlichkeit.

In einer kompakten Präsentationsrunde stellten sich alle 13 geförderten Forschungsverbünde vor. Die Bandbreite der Vorhaben reichte von VR-basierten Familiensimulationen und gamifizierten Emotionsregulationstrainings bis hin zu mobilen Anwendungen für Therapieübergänge oder Wartezeitenüberbrückung. Allen gemein ist der hohe Grad an Partizipation: Sie binden Kinder, Eltern und Fachkräfte aktiv in die Technologieentwicklung ein – sowohl zur Sicherung der Akzeptanz als auch zur Förderung der Selbstwirksamkeit.
Eine vollständige Projektübersicht mit entsprechenden Kurzbeschreibungen finden Sie hier.
Am zweiten Veranstaltungstag diskutierten die Teilnehmenden in vier themenspezifischen Workshops zentrale Aspekte der Fördermaßnahme: Wissenschaftskommunikation, Evaluation, Stigma sowie Mensch-Technik-Interaktion und Technikfolgenabschätzung.
Das Auftakttreffen markierte einen gelungenen Start für eine Fördermaßnahme, die innovative Technologien mit einem gesellschaftlich dringlichen Thema verbindet.
In den kommenden Jahren werden die GamKi-Projekte zeigen, wie digitale Anwendungen kindgerecht gestaltet werden können, um Versorgungslücken zu schließen, Therapie zu unterstützen – und nicht zuletzt das gesellschaftliche Bild psychischer Erkrankungen zu verändern.